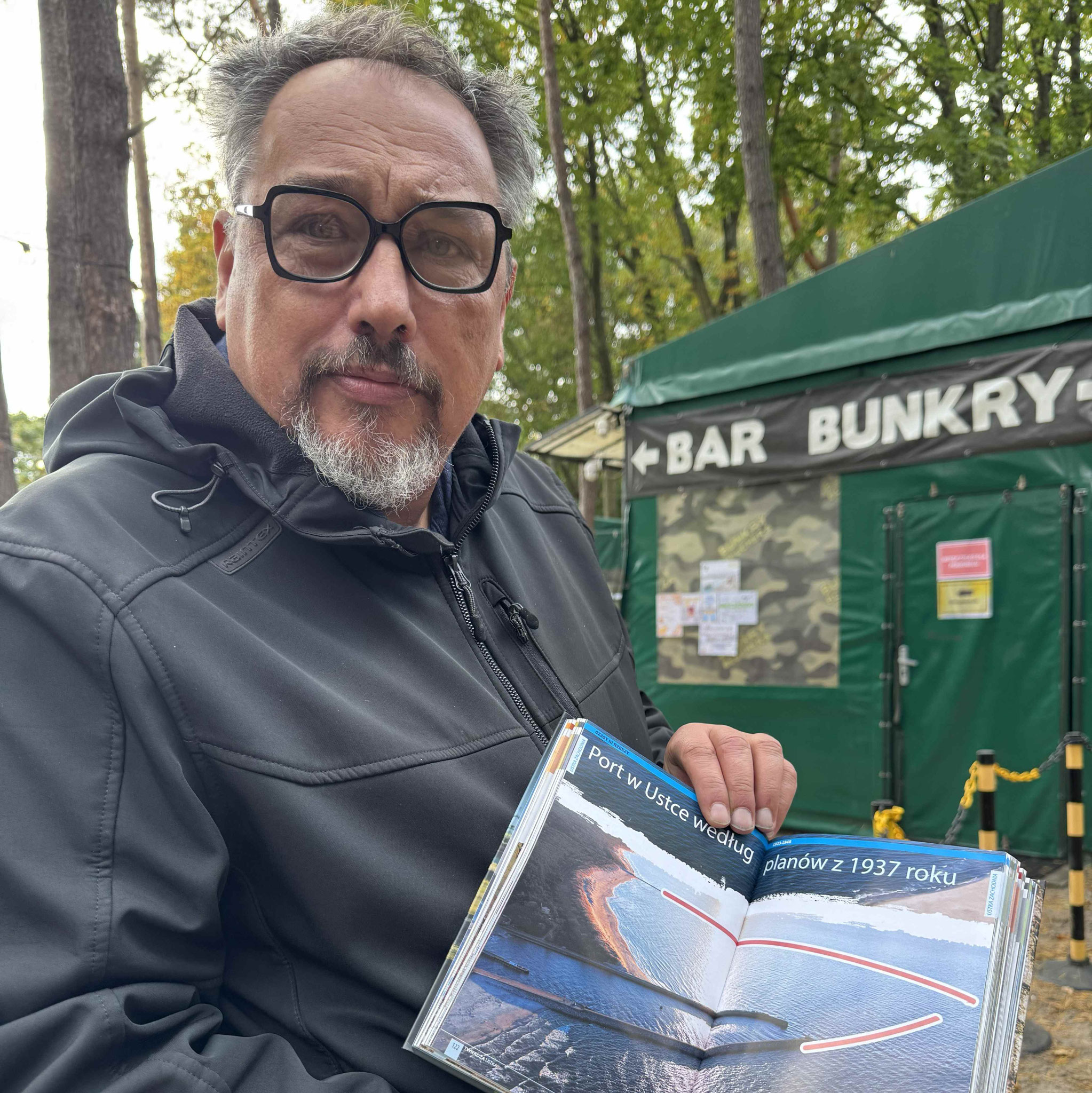Marcin Branowski begrüßt mich sofort auf Deutsch. „In der Schule musste ich Russisch lernen, mochte die Sprache aber nicht“, erklärt der 62-Jährige in Ustka an der polnischen Ostseeküste. „Da ich aber studieren wollte, brauchte ich gute Noten. Mein Großvater, der aus Belarus stammte, versorgte mich mit russischer Literatur.“ Marcin studierte Geschichte und Archivwissenschaften in Poznań. „Aber im Archiv waren die meisten historischen Dokumente auf Deutsch. Also lernte ich Deutsch und sogar die Sütterlin-Schrift.“
Marcin ist in Ustka aufgewachsen und zog auch nach Ende des Studiums wieder in die Hafenstadt. Er arbeitete zunächst als Lehrer, dann als Journalist. Über Jahrhunderte war Ustka (Stolpmünde) ein militärisch wichtiger Standort zur Verteidigung der Küste. Die Nazis planten hier einen gigantischen Kriegshafen, das Projekt wurde nie realisiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg behielt Ustka seine militärische Bedeutung bei und wurde ein bedeutender Stützpunkt der polnischen Streitkräfte und des Warschauer Paktes. Die Bunkeranlagen der Deutschen wurden zunächst weiter genutzt und auch ausgebaut. „Doch irgendwann in den 1970er Jahren standen sie leer. Niemand kümmerte sich mehr darum, so dass wir als Kinder in den alten Bunkern spielten“, erinnert sich Marcin.
Die Menschen in Ustka wussten während des Kalten Krieges wenig über die militärischen Details und über die Nutzung des Militärgeländes durch den Warschauer Pakt. Marcin erzählt, dass die Menschen in dem beschaulichen Städtchen unter ständiger Beobachtung standen. Der Historiker hat sich intensiv mit der lokalen Geschichte Pommerns und speziell mit der Geschichte Ustkas beschäftigt. „Die Menschen lebten hier wirklich hinter dem Eisernen Vorhang. Die Ostseeküste wurde streng bewacht.“
Dabei war das nicht immer so. Nach 1945 machte sich in der Stadt große Hoffnung breit. „Die großen Häfen in Danzig und Stettin waren zerstört und noch geschlossen, aber unser kleiner Hafen lebte.“ Marcin berichtete, dass von hier aus vor allem Kohle aus Schlesien verschifft wurde. Auch die Werft entwickelte sich gut. Somit gab es Arbeitsplätze und es kamen Menschen nach Ustka. Kleine Restaurants, Läden und Hotels eröffneten. Viele hatten privat eine kleine Landwirtschaft und konnten sich etwas dazuverdienen. „Alle haben gehofft, dass sich der von Winston Churchill 1946 prophezeite Eiserne Vorhang vielleicht doch nicht senken würde. Viele träumten davon, dass der Hafen für Ustka ein Tor zur Welt sein würde. Doch diese Hoffnung verschwand, nicht von einem Tag auf den anderen, aber allmählich.“ Der Historiker zählt auf: Die Ostsee durfte nicht mehr von Hobbyseglern genutzt werden. Freizeitboote wurden verboten. Immer mehr Grenzbeamte waren im Ort stationiert. Der Strand wurde regelmäßig geeggt, um eventuelle Fußspuren zu erkennen. Die Landwirtschaft und Fischerei wurden kollektiviert, der private Handel stark eingeschränkt. Fischer, die mit ihren Booten regelmäßig aufs Meer fuhren, wurden streng kontrolliert, ob sie auch vertrauenswürdig seien. „Teilweise waren auch Mitarbeitende des Geheimdienstes an Bord mancher Fischerboote.“
Ustka wurde zum Sperrbezirk erklärt. „Das heißt, nur ausgewählte Menschen konnten im Urlaub an die Ostsee fahren. In der Regel wurde das über die Betriebe organisiert“, erinnert sich Marcin. „Eine Chance auf ein paar Tage am Ostseestrand hatten aber nur Personen, die sich besonders verdient gemacht hatten und vertrauenswürdig waren.“
Marcin ist es ein großes Bedürfnis, sein geschichtliches Wissen zu teilen. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Geschichte Pommerns und der Hafenstadt Ustka. Er hat die ehemaligen militärischen Anlagen am westlichen Stadtrand direkt hinter dem Hafengelände gepachtet und vor über zehn Jahren zu einem Geschichtspark mit einem Museum im historischen Blücher-Bunker entwickelt.
Marcin erzählt schnell und viel. Die einzelnen Geschichten, die er im Laufe der Jahre durch Zeitzeugengespräche und Dokumenteneinsicht erfahren hat, sprudeln nur so aus ihm raus.
Er erzählt von dem jungen Ingenieur, der aus einer anderen Region Polens kam, um in der Werft zu arbeiten. Beim Schweißen hat er sich die Augen verletzt, so dass er sehr lichtempfindlich war. So ging er nachts an den Strand und blickte auf das dunkle Meer. Das kam den Grenzschützern verdächtigt vor. Sie sprachen ihn an und verlangten seine Papiere. Er soll geantwortet haben: „Ich kann das alles nicht mehr sehen.“ Wie die Grenzschützer diese Aussage interpretierten, ist nicht bekannt.
Von Ustka aus hat es laut den Recherchen von Marcin auch mehrere Fluchten gegeben. Während Polen Anfang der 1980er Jahre unter Kriegsrecht stand, kidnappte ein Mann ein Agrarflugzeug, das normalerweise zum Düngen oder zur Schädlingsbekämpfung genutzt wurde. Er sammelte zwei Familien auf und startete die Maschine Richtung Bornholm. Er wurde von polnischen Tieffliegern verfolgt, entkam dem Beschuss, weil er sehr tief flog. Alle erreichten Bornholm. „Eine sehr riskante, aber erfolgreiche Verzweiflungstat“, kommentiert Marcin.
Ustka oder Stolpmünde ist auch aus einem weiteren Grund in die Geschichtsbücher eingegangen: Im Januar 1945 hat ein sowjetisches U-Boot die „Wilhelm Gustloff“ etwa 23 Seemeilen vor der Stolpmünder Küste versenkt. Über 9000 Menschen aus Ostpreußen, die vor der Roten Armee flüchteten, starben. Es war der verlustreichste Untergang eines einzelnen Schiffes in der Geschichte der Seefahrt. Von den schätzungsweise 10.000 Menschen an Bord konnten nur 1239 gerettet werden. Im Februar 1945 versenkte dasselbe U-Boot auch den Passagierdampfer „Steuben“ mit verwundeten Soldaten und Flüchtlingen vor Stolpmünde. Zwischen 1100 und 4200 Menschen kamen ums Leben.
Der Hafen von Ustka spielte bei der Evakuierung der Flüchtlinge eine große Rolle: Bis zum März 1945 verließen etwa 33 000 Menschen Pommern über den Hafen Stolpmünde in Richtung Westen.
Als Handelshafen und Werftstandort spielt Ustka heute kaum mehr eine Rolle. Dafür liegen Fischer- und Freizeitboote an den Stegen. Teile der Mauer, die den streng bewachten Hafen während des Kalten Krieges umgab, existieren noch. Aber es gibt genügend Durchbrüche, so dass Touristen heute durch die Hafenanlage bummeln können. Eine neue Schwenkbrücke über die Stolpe als touristische Attraktion verbindet die städtische Promenade mit dem Hafen und den ehemaligen Bunkeranlagen. Die Küste bei Ustka ist strategisch immer noch wichtig. Westlich der Hafenstadt ist die Küste über mehrere Kilometer gesperrt, da hier ein militärisches Sperrgebiet der polnischen Armee und der Nato liegt.
Marcin beobachtet das Geschehen in seiner Heimatstadt sehr genau. Er ist auch eine Art Chronist und dokumentiert die aktuelle Geschichte. Seine Hoffnung ist, dass sich Ustka zu einem Kurort entwickelt, aber auch gleichzeitig für junge Leute attraktiv ist. „Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung“, freut er sich. Marcin wird seinen Beitrag dazu leisten, dass die Erinnerung an die vielfältige Geschichte der kleinen Hafenstadt lebendig bleibt. Während sich viele seiner Freunde in unterschiedlichsten Berufen Gedanken über den Ruhestand machen, denkt er nicht ans Aufhören. „Ich brenne für diese Themen und folge dem Motto der mittelalterlichen Zisterziensermönche Ora et Labora – so lange ich kann, für mich und Ustka.